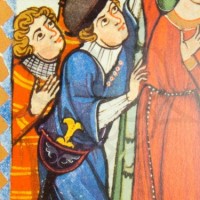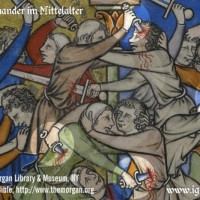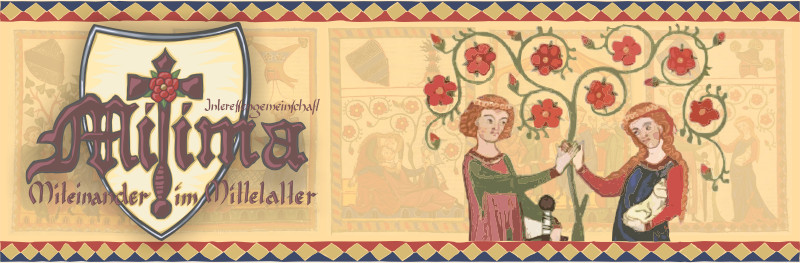
 Baselard
Baselard

 Allgemein
Allgemein
Dies ist eine Replik eines Baselard (auch basilard, baslard, in Mittel Französisch auch badelare, Bazelaire und Varianten, latininzed baselardus, basolardus usw. in Mittelhochdeutsch Beseler, Baseler, Basler, Pasler, baslermesser) eine historische Art von langen Dolch oder Kurzschwert des hohen und späten Mittelalter[1]. Kennzeichnend für diese Art von Dolch ist über die Jahrhunderte hinweg der Griff in Form eines "I" / einer römischen "1".
Kennzeichnend für die frühen Entwicklungen des Dolches, die erstmals im 13. Jahrhundert auftauchten ist insbesondere die stark geschwungene Parierstange. Dieses frühere Modell hat als "Knauf" ein Spiegelbild der Parierstange. Im 14. Jahrhundert verschwindet die geschwungene Parierstange und die Form des Griffes wird eher rechtwinklig.[2]
Der Dolch / Die Klinge
Das Original ist im Besitz des Bayreischen Armeemuseums in Ingolstadt. Nach verschiedenen zeitgenössichen Abbildungen, u.a. in der Kreuzfahrer Bibel (Maciejowski-Bibel)[3] und in der großen heidelberger Liederhandschrift (Manesse)[4] wurde diese Art des Dolches, als auch dessen Varianten im 12. und 13. Jahrhundert in Westeuropa verwendet.
Der Dolch hat eine Gesamtlänge von 41 cm und wurde von Arma Bohemia aus Federstahl gefertigt - Klingenlänge 28 cm. An der Papierstnage und am Knauf wurde jeweils am Ende in der Wickung Buntmetall - hier Kupfer - eingesetzt. Für den Griff wurde Pflaumenholz verwendet.
Die Scheide
Die von uns gefertigte Dolchscheide ist an den schleswiger Fundkomplex (Schnack, Abb. 21) angelehnt.[5] Sie besteht aus einem Holzkern aus Weißbuche / Hainbuche[6], der mit Lederstreifen aus Rinderblankleder unterfüttert und danach - ebenfalls mit Rindsleder umspannt und überwendlich vernäht wurde. Lediglich an der Öffnung wurde das Leder mit ein wenig Knochnleim fixiert.
Problematisch waren zunächst die angebrachten Verziehrungen. Die Lederfunde auf dem sog. schleswiger Schild seien nicht eindeutig Dolchscheiden zuzuordnen gewesen. Daher haben wir uns bei der Dochscheide an den gefundenen Schwertscheiden, die vermutlich der Machart der Dolchscheide an nähesten kommen, orientiert. Eine der geläufisten Verziehrungen auf mittelalterlichen Schwertscheiden bestehe nach Schnack aus einer einfachen Relieflinienzier, die sich in der Regel parallel der Längstkanten entlangziehe. Sie könne vereinzelnt durch strahlenförmige Kreuzmotive bereichert sein. Vergleichfunde seien in Svendborg (1279 - 1300)[7] und Lund (13. / 14.)[8] gegeben.
Quellen und Weiterführendes
- vgl. hierzu Wikipedia.org: Baselard (englische Seite).
- Jürg A. Meier, Sammlung Carl Beck, Sursee (1998). http://www.waffensammlung-beck.ch/waffe197.html.
- The Morgan - Picture Bible / Crussader Bible, The Morgan Library & Museum, New York, USA - Online Exhibitions, www.themorgan.org.
- Große Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse), Zürich, ca. 1300 bis ca. 1340, Universitätsbibliothek Heidelberg, http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848.
- Schnack, Christiane: Ausgrabungen in Schleswig, Berichte und Studien 13, Mittelalterliche Lederfunde aus Schleswig - Futterale, Riemen, Taschen und andere Objekte, S. 38 ff. , Wachholtz Verlag, Neumünster 1998;
- Die (Gemeine) Hainbuche (Carpinus betulus), auch Weißbuche, Hagebuche oder Hornbaum genannt, gehört zur Gattung der Hainbuchen (Carpinus) aus der Familie der Birkengewächse (Betulaceae). Sie wächst als mittelgroßer, laubabwerfender Baum oder Strauch in Europa und Westasien. Entgegen dem, was ihre deutschsprachigen Namen suggerieren, ist sie nicht näher mit der (einzigen in Mitteleuropa vertretenen Buchenart) Rotbuche (Fagus sylvatica) verwandt. Diese gehört vielmehr zur Gattung der Buchen (Fagus) innerhalb der Familie der Buchengewächse (Fagaceae). Lediglich derselben Ordnung (Buchenartige (Fagales)) gehören Hainbuche und Rotbuche an. [Quelle: Wikepedia - Hainbuche].
- vgl. Groenmann-van Waateringe 1988 a, S. 101; Abb. 7.5.5.10. (Quelle nicht geprüft).
- vgl. Blomqvist 1938, Abb. 39 - 43; 13 Jh., Bergmann und Billberg 1976, Abb. 349. (Quelle nicht geprüft).

 Willkommen
Willkommen Wer wir sind
Wer wir sind Darstellung
Darstellung Sachkultur
Sachkultur Termine
Termine Links
Links Kontakt
Kontakt